Dämmstoffe im Vergleich [+ Tabellen zur Anwendung und Dämmwerten]
30. Juli 2025Ein umfassender Vergleich der Eigenschaften und Dämmwerte verschiedener Materialien. Finde die optimale Lösung für deine Anforderungen!
Inhaltsverzeichnis
Eine gute Dämmung reduziert Heizkosten, hält den Wohnraum im Sommer kühl und trägt außerdem zum Klimaschutz bei. Einer der wichtigsten Entscheidungsfaktoren ist der U-Wert des Dämmmaterials, der angibt, wie effizient ein Material dämmt. Außerdem müssen die Anforderungen der gesetzlichen Normen und Vorschriften zur Dämmung befolgt werden. Nicht zuletzt sind die Unterschiede bei der Umweltverträglichkeit von Dämmstoffen gravierend. Verschaff dir hier einen Überblick über die Eigenschaften, Vor- und Nachteile der gängigsten Dämmmaterialien!
Übersicht der gängigen Dämmstoffe und deren Eigenschaften
Synthetische Dämmstoffe
Synthetische Dämmstoffe werden aus fossilen Rohstoffen (meist Erdöl) hergestellt und durch chemische Prozesse zu Dämmmaterialien verarbeitet.
Synthetische Dämmstoffe haben viele Vorteile:
- Ihre geringe Wärmeleitfähigkeit lässt oft zu, dass sie dünner sind als natürliche Dämmstoffe (brauchen weniger Platz/Dicke).
- Synthetische Dämmstoffe sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit, eignen sich daher gut für erdnahe Bauteile.
- Sie sind leicht verarbeitbar (oft in Platten oder als Schaum).
- Sie sind druckfester als Naturdämmstoffe (gut für z.B. Bodenplatten).
- Sie können nicht von Schädlingen befallen werden oder verrotten.
- Synthetische Dämmstoffe sind kosteneffizienter als Naturdämmstoffe.
Synthetische Dämmstoffe sind also technisch effizient, haben aber eine deutlich schlechtere Ökobilanz als Dämmmaterialien aus natürlichen Stoffen:
- Hohe graue Energie (energieintensive Herstellung)
- Nutzung fossiler Rohstoffe
- Schwer recyclebar --> oft Sondermüll
- Mikroplastik durch Zerfall belastet die Umwelt
Sie sollten nur dort eingesetzt werden, wo natürliche Dämmstoffe nicht infrage kommen (z. B. bei Feuchtigkeit). Für nachhaltiges Bauen sind organische oder mineralische Alternativen (z. B. Holzfaser, Kork, Zellulose) meist die bessere Wahl.
Typische synthetische Dämmstoffe und ihre Anwendungen:
Expandiertes Polystyrol (EPS)
EPS ist günstig, wiegt sehr wenig, und die Verarbeitung ist einfach. Allerdings ist es brennbar. Die geringe Rohdichte macht das Material gut dämmend, aber auch empfindlich. EPS (Styropor) wird oft zur Außenwände- und Perimeterdämmung sowie für Dächer verwendet.
Extrudiertes Polystyrol (XPS)
XPS ist fester, wasserbeständiger und druckfester als EPS. Es ist allerdings auch noch schlechter zu recyclen. XPS wird oft verwendet für die Dämmung von Kellern, Flachdächern und Bodenplatten.

Polyurethan (PUR/PIR)
PUR/PIR erlaubt oft die dünnsten Schichten, da es eine noch höhere Dämmwirkung hat als EPS oder XPS. Die Herstellung ist allerdings extrem umweltschädlich. Typische Anwendungsbereiche für Polyurethan sind Dämmungen in der Industrie und bei Kühlhäusern.

Phenolharz (Resolharz-Schaum)
Phenolharz ist besonders schwer entflammbar und wird daher vor allem in Hochsicherheitsbereichen (Industrie, Schiffsbau) zum Brandschutz verwendet. Nachteile sind der hohe Preis und mögliche gesundheitlich bedenkliche Emissionen.
Mineralische Dämmstoffe
Mineralische Dämmstoffe bestehen in der Regel aus mineralischen Fasern oder Schaumstoffen, die auf natürlichen Rohstoffen wie Stein- oder Glaswolle basieren (zum Beispiel Steinwolle, Glaswolle, Blähglas oder Blähkeramik). Diese natürlichen Materialien haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und hohe Dämmwirkung. Dadurch eignen sie sich für die Isolierung von Wänden, Dächern und Böden.
Mineralische Dämmstoffe sind im Vergleich zu organischen oder synthetischen Dämmstoffen resistenter gegen hohe Temperaturen und weniger brennbar.
Typische Anwendungsbereiche für mineralische Dämmstoffe sind daher:
- Brandschutz: in Gebäuden, Tunneln, und anderen baulichen Anlagen, wo der Schutz vor Bränden und die Verhinderung der Brandausbreitung von entscheidender Bedeutung sind.
- Wärmedämmung: in Bereichen, in denen eine effiziente Isolierung gegen Wärmeverlust erforderlich ist, wie zum Beispiel bei Fassaden, Dächern, und Decken.
- Schalldämmung: in Gebäuden, in denen eine Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen notwendig ist, wie beispielsweise in Mehrfamilienhäusern, Schulen, und Bürogebäuden.
Zudem sind mineralische Dämmstoffe ökologisch unbedenklich und recyclebar, was sie im Vergleich zu synthetischen Materialien zu einer nachhaltigeren Option macht.
Typische mineralische Dämmstoffe und ihre Anwendungen:
Glaswolle
Hergestellt aus geschmolzenem Glas, das zu feinen Fasern verarbeitet wird. Sie wird vor allem in der Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
Steinwolle
Ähnlich wie Glaswolle, aber aus geschmolzenem Stein hergestellt. Auch sie findet Anwendung in der Wärme- und Schalldämmung.
Blähglas
Ein mineralischer Dämmstoff, der aus recyceltem Altglas hergestellt wird und vor allem für die Wärmedämmung verwendet wird.
Perlite
Ein vulkanisches Gestein, das bei hohen Temperaturen expandiert wird. Es wird in Dämmputzen, Leichtmörtel und als Schüttung eingesetzt.
Organische Dämmstoffe
Organische Dämmstoffe bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen. Diese können pflanzlich oder tierisch sein. Da diese biologisch abbaubar und mit geringerem Energieaufwand in der Herstellung verbunden sind, haben organische Dämmmaterialien eine besonders gute Ökobilanz. Sie binden CO₂ und tragen zur Kreislaufwirtschaft bei (z. B. Zellulose aus Recyclingpapier). Im Vergleich zu synthetischen Dämmstoffen (z. B. Polystyrol) verursachen sie weniger Mikroplastik und sind am Ende ihrer Lebensdauer kompostierbar oder wiederverwertbar.
Organische Dämmstoffe sind außerdem besonders diffusionsoffen: Sie regulieren gut die Feuchtigkeit und verbessern das Raumklima. Zusätzlich sind sie meist schwer entflammbar oder sogar selbstverlöschend (Kork).
Typische organische Dämmstoffe:
- Holzfaser
- Kork
- Hanf
- Flachs
- Schafwolle
- Zellulose aus Altpapier
Kork dämmt Schall besser als viele synthetische Materialien. Es eignet sich daher besonders gut für die Trittschall- und Bodendämmung. Es ist außerdem formstabil, langlebig und resistent gegen Schimmel und Schädlinge. Der Nachteil ist, dass Kork teilweise schwer verfügbar und deutlich teurer als viele andere Materialien ist. Typische Anwendungsbereiche: Aufsparrendämmung, Trittschalldämmung.
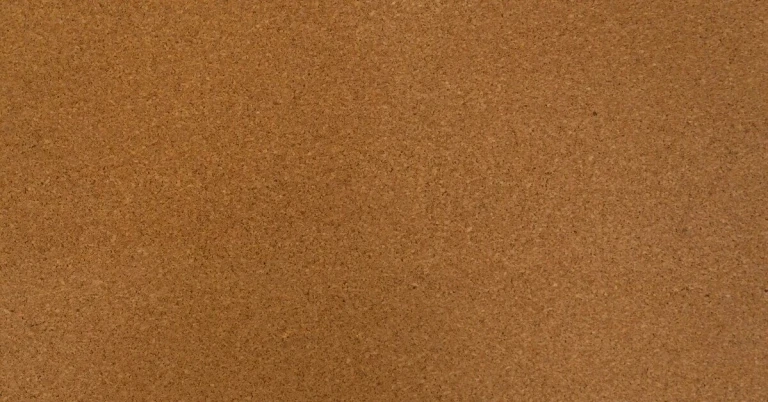
Holzfaser weist eine hohe Speichermasse auf, was bei massiven Holzbauweisen ein Vorteil ist. Sie bietet eine gute Wärmedämmung im Winter sowie Hitzeschutz im Sommer. Allerdings kann Holzfaser ohne Schutz vor Feuchtigkeit anfällig für Schimmel sein. Typische Anwendungsbereiche: Dachdämmung, Fassadendämmung.
Tabelle: Vergleich von Dämmstoffen und ihren Eigenschaften
| Material | Typ | Hauptanwendung | Besonderheiten | Brandschutzklasse |
|---|---|---|---|---|
| Holzfaser | Organisch | Dach, Wand, Decke | Guter Hitzeschutz im Sommer, diffusionsoffen | B2 (normal entflammbar) |
| Zellulose | Organisch (recycelt) | Einblasdämmung, Zwischensparren | Gute Schalldämmung, recyclingfähig | B2 |
| Hanf/Flachs | Organisch | Wand, Dach, Holzrahmenbau | Nachwachsend, feuchtigkeitsregulierend | B2 |
| Kork | Organisch | Boden, Trittschalldämmung | Natürlich, resistent gegen Schimmel | B1 (schwer entflammbar) |
| Schafwolle | Organisch | Innenwände, Dach | Selbstreinigend, gut für Allergiker | B2 |
| Glaswolle | Mineralisch | Dach, Fassade, Rohrleitungen | Nicht brennbar (A1), günstig | A1 (nicht brennbar) |
| Steinwolle | Mineralisch | Fassade, Brandschutz, Dach | Hoch temperaturbeständig (> 1000°C) | A1 |
| Perlite | Mineralisch | Schüttdämmung, Hohlräume | Natürlich, chemiefrei | A1 |
| EPS (Styropor) | Synthetisch | Fassade (WDVS), Bodenplatten | Leicht, wasserabweisend, günstig | B1 (mit Flammschutz) |
| XPS | Synthetisch | Keller, Flachdach, Perimeterdämmung | Druckfest, feuchtigkeitsresistent | B1 |
| PUR/PIR | Synthetisch | Flachdach, Industriebau | Höchste Dämmwirkung bei geringster Dicke | B1/B2 |
Wichtigkeit des Dämmwerts bei der Materialwahl
Der Begriff „Dämmwert“ wird oft umgangssprachlich verwendet, bezieht sich aber meist auf den U-Wert – Wärmedurchgangskoeffizient. Es gibt jedoch mehrere Kennzahlen, die als Dämmwerte die Dämmleistung beschreiben.

Der λ-Wert (Wärmeleitfähigkeit)
Die Wärmeleitfähigkeit misst, wie gut ein Material Wärme leitet (= durchlässt). Je niedriger der λ-Wert, desto besser dämmt das Material. Die Einheit des λ-Werts ist W/(m·K) (Watt pro Meter und Kelvin).
Styropor hat zum Beispiel eine Wärmeleitfähigkeit von λ = 0.035–0.045 (eine gute Dämmung). Beton liegt bei einer Wärmeleitfähigkeit von ca. 2.1 (nicht besonders gut).
Dämmstoffe werden anhand des λ-Werts in Wärmeleitfähigkeitsgruppen (WLG) eingeteilt: Ein Stoff, der in die WLG 035 eingeordnet ist, hat einen λ-Wert von 0.035 (z.B. EPS/Styropor). Je kleiner die WLG-Zahl, desto besser die Dämmwirkung, und desto dünner muss die Dicke der Dämmschicht nach GEG-Anforderungen sein. Früher gab es außerdem die WLS (Wärmeleitstufe) als Einordnung von Dämmstoffen. Diese wurde aber heute durch die WLG ersetzt.
Der R-Wert (Wärmedurchlasswiderstand)
Der R-Wert beschreibt den Widerstand eines Materials gegen Wärmefluss. In anderen Worten: Wie stark hält ein Material Wärme auf? Je höher der R-Wert, desto besser eignet sich ein Material zur Dämmung. Die Einheit des R-Werts ist (m² · K) / W. Das W steht für Watt, das K für Kelvin. Berechnet wird der Wärmedurchlasswiderstand mit der Formel R = Dicke (in Metern) / λ-Wert, also die Dicke des Materials geteilt durch seine Wärmeleitfähigkeit.
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter durch ein Bauteil (z. B. Wand oder Dach) entweicht. Dieser Wert bezieht sich also nicht nur auf das Dämmmaterial selbst, sondern auf die Wand als Ganzes (inklusive Putz, Dämmung, etc.)
Je niedriger der U-Wert, desto effektiver ist die Dämmung. Ein niedriger U-Wert führt zu weniger Wärmeverlust und verringert somit den Heizbedarf. Zum Beispiel: Eine Fassade mit U = 0,20 verliert viermal weniger Energie als eine mit U = 0,80.
Der U-Wert wird angegeben als W / (m² · K). Das W steht für Watt, das K für Kelvin. Berechnet wird der U-Wert eines Dämmmaterials mit der Formel U = 1 / Rges ). Rges ist dabei die Summe aller R-Werte in der Wand.
Der C-Wert (Wärmespeicherkapazität)
Die spezifische Wärmekapazität gibt an, wie viel Energie nötig wäre, um 1 kg des Materials auf 1 Kelvin zu erwärmen. In der Praxis bedeutet dies, das Materialien mit einem hohen C-Wert viel Wärme speichern und sie langsam abgeben. Synthetische Dämmstoffe haben tendenziell einen geringere Wärmespeicherkapazität und speichern weniger Hitze. Damit dämmen sie zwar gut, helfen aber nicht dagegen, dass sich ein Innenraum bei Hitze schnell aufheizt. Materialien wie Holzfaser absorbieren und speichern mehr Wärme, statt sie direkt ins Gebäude abzugeben, und halten so im Sommer Räume kühler.
Tabelle: Vergleich der Dämmwerte von verschiedenen Dämmstoffen
| Material | Typ | λ-Wert [W/(m·K)] | R-Wert (bei 10 cm) |
|---|---|---|---|
| Holzfaser | Organisch | 0,040 – 0,050 | 2,0 – 2,5 |
| Kork | Organisch | 0,040 – 0,050 | 2,0 – 2,5 |
| Hanf/Flachs | Organisch | 0,040 – 0,045 | 2,2 – 2,5 |
| Zellulose | Organisch (Recycelt) | 0,040 – 0,045 | 2,2 – 2,5 |
| Schafwolle | Organisch | 0,035 – 0,040 | 2,5 – 2,9 |
| Glaswolle | Mineralisch | 0,032 – 0,040 | 2,5 – 3,1 |
| Steinwolle | Mineralisch | 0,035 – 0,040 | 2,5 – 2,9 |
| Perlite | Mineralisch | 0,045 – 0,055 | 1,8 – 2,2 |
| EPS (Styropor) | Synthetisch | 0,032 – 0,040 | 2,5 – 3,1 |
| XPS | Synthetisch | 0,030 – 0,035 | 2,9 – 3,3 |
| PUR/PIR | Synthetisch | 0,022 – 0,028 | 3,6 – 4,5 |
So berechnest du aus der Tabelle den U-Wert einer Wand:
Nehmen wir eine Beispiel-Wand mit 20 cm Holzfaser (λ = 0,045).
R = 0.2 m / 0.045 ≈ 4.44. Damit ist der U-Wert in diesem Fall U = 1 / 4.44 ≈ 0.23. Das ist nach GEG ein guter Wert für eine Außenwand.
Regulierungen und Normen zur Dämmung
In Deutschland und der EU gelten strenge Vorgaben zur Energieeffizienz von Gebäuden. Bei der Auswahl der Dämmstoffe solltest du dir über diese Regeln im Klaren sein.
Zum Beispiel regelt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) die maximal erlaubten U-Werte. Der Primärenergiebedarf für die Dämmung muss nachgewiesen werden. DIN-Normen wie die DIN 41-08-10 regeln Mindestdämmstandards für Neubauten und Sanierungen, sowie Brandschutzanforderungen für verschiedene Baustoffe. Umweltproduktdeklarationen sind ebenfalls wichtig zu beachten. Sie bewerten die Ökobilanz der Dämmstoffe (z.B. Cradle-to-Cradle-Zertifizierung).
Kosten und Fördermöglichkeiten für Dämmstoffe
Tabelle: Preisvergleich gängiger Dämmmaterialien
| Material | Typ | Preis/m² (10 cm) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| EPS (Styropor) | Synthetisch | 8–12 € | Günstigster Standard-Dämmstoff |
| Glaswolle | Mineralisch | 10–15 € | Nicht brennbar, mittlere Preislage |
| Steinwolle | Mineralisch | 12–18 € | Höherer Preis als Glaswolle |
| XPS | Synthetisch | 15–22 € | Teurer als EPS, aber wasserfest |
| Zellulose | Organisch | 18–25 € | Recyclingmaterial, gute Ökobilanz |
| Holzfaser | Organisch | 22–30 € | Höhere Speicherfähigkeit |
| Hanf/Flachs | Organisch | 25–35 € | Nachwachsend, gute Feuchteregulierung |
| PUR/PIR | 30–45 € | Teuerste synthetische Option | |
| Kork | Organisch | 35–50 € | Natürlich, aber hochpreisig |
| Schafwolle | Organisch | 40–60 € | Nischendämmstoff, hoher Komfort |
Anmerkung: Preise variieren nach Region und Hersteller und sind ohne Gewähr. Synthetische Dämmstoffe im Besonderen unterliegen starken Ölpreisschwankungen. Denke außerdem zusätzlich zu den Materialkosten an die Einbaukosten: Organische Stoffe sind oft aufwändiger in der Verarbeitung.
Schlusswort
Die beste Ökobilanz erreichst du mit Holzfaser, Hanf oder Zellulose. Steinwolle und Glaswolle sind am sichersten im Brandschutz. Die beste Dämmwirkung bei der dünnsten Schicht haben PUR/PIR und XPS. Die beste Dämmung im individuellen Bauvorhaben hängt von den speziellen Anforderungen ab. Deine Profi-Ansprechpartner:innen sind:
- Energieberater:innen (berechnen U-Werte, kennen Förderprogramme)
- Dachdecker:innen (für Dachdämmung)
- Maurer:innen und Fassadenspezialist:innen (für Außenwanddämmung)
- Bodenleger:innen (für Trittschalldämmung)
Die komplette Koordination eines Projekts übernehmen Architekt:innen oder Energieberater:innen.
Lass dich von einem Profi-Betrieb beraten, um das beste Ergebnis für deine Dämmung zu erhalten.

 Foto von
Foto von